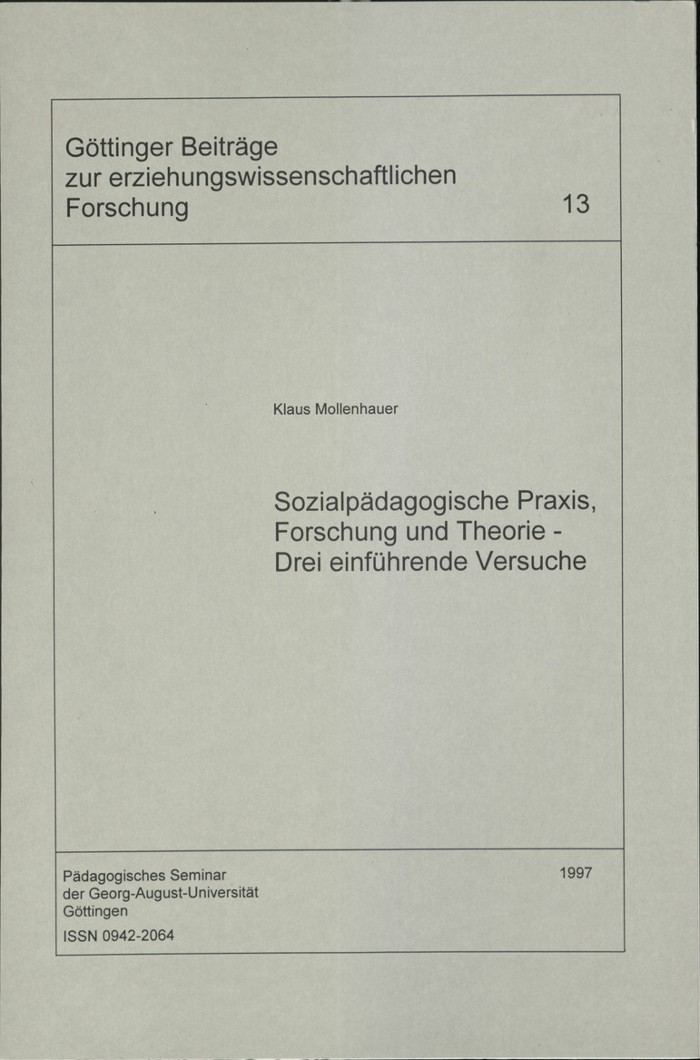[V83:6] Baethge,
M./Hantsche, B./Pellul, W./Voßkamp, U.: Jugend: Arbeit und
Identität. Lebensperspektiven und Interessenorientierungen von
Jugendlichen. Opladen 1988
[V83:7] Blandow,
J./Faltermeier, J. (Hrsg.): Erziehungshilfen
in der Bundesrepublik Deutschland. Stand und Entwicklung. Frankfurt/M.
1989
[V83:8] Böhnisch,
L./Münchmeier, R.: Wozu Jugendarbeit?
Orientierungen für Ausbildung, Fortbildung und Praxis. Weinheim/München
1987
[V83:9] Bonstedt,
Chr.: Organisierte Verfestigung abweichenden Verhaltens. München
1972
[V83:10] Bourdieu, P.: Entwurf einer Theorie der Praxis. Frankfurt/M.
1976
[V83:11] Brumlik,
M.: Advokatorische Ethik. Zur Legitimation pädagogischer Eingriffe.
Bielefeld 1992
[V83:12] Brumlik,
M.: Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Berlin 1995
[V83:13] Büchner,
P.: Generation und Generationenverhältnis. In: Krüger/Helsper, a. a. O.
[V83:14] Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: Zweiter
Familienbericht. Familie und Sozialisation, Bonn-Bad Godesberg
1975
[V83:15] Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit:
Achter Jugendbericht. Bericht über Bestrebungen und Leistungen der
Jugendhilfe, Bonn 1990
[V83:16] Colberg-Schrader, H./Krug, M.:
Arbeitsfeld Kindergarten, München 1977
[V83:17] Cramer,
F.: Symphonie des Lebendigen. Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie.
Frankfurt/M. 1996
[V83:18] Deutscher
Bundestag: Drucksache 10/6739, Reform des
Jugendgerichtsverfahrens, Bonn 1986
[V83:19] Eisenstadt, S. N.: Von Generation zu Generation. München
1966
[V83:20] Erning, G./Neumann, K./Reyer, J. (Hrgs.): Geschichte des Kindergartens, 2 Bände, Freiburg
1987
[V83:21] Fatke,
R./Hornstein, W.: Sozialpädagogik –
Entwicklungen, Tendenzen, Probleme. In: ZfPäd. 1987, Heft 5, S. 589 –
593
[V83:22] Flösser,
G./Otto, H.-U.: Professionelle Perspektiven
der Sozialen Arbeit. Zwischen Lebenswelt- und
Dienstleistungsorientierung. In: Grunwald u. a.,
a. a. O.
[V83:23] Gängler,
H./Rauschenbach, Th.:
„Sozialarbeitswissenschaft“
ist die Antwort. Was aber war die
Frage? In: Grunwald u. a., a. a. O.
[V83:24] Gängler,
H.: Hilfe. In: Krüger/Helsper, a. a. O., S. 131 – 138
[V83:25] Geertz,
C.: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme.
Frankfurt/M. 1987
[V83:26] Giesecke, H.: Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle von Eltern
und Lehrern. Stuttgart 1996
[V83:27] Grunwald, K./Ortmann, Fr./Rauschenbach, Th./Treptow, R. (Hrsg.):
Alltag, Nicht-Alltägliches, und die Lebenswelt. Beiträge zur
lebensweltorientierten Sozialpädagogik. Weinheim/München
1996
[V83:28] Gruschka, A. (Hrsg.): Wozu Pädagogik? Die Zukunft bürgerlicher
Mündigkeit und öffentlicher Erziehung. Darmstadt 1996
[V83:29] Habermas, J.: Theorie des kommunikativen
Handelns. 2 Bände. Frankfurt/M. 1981
[V83:30] Hamburger, F.: Grenzenlose Fremdheit. In:
Sozialwissenschaftliche Literatur-Rundschau, Heft 33, 1996, S. 20 –
27
[V83:31] Hamburger, F.: Überlegungen zur Lage der universitären
Sozialpädagogik. In: Erziehungswissenschaft, Heft 12, 1995, S. 92 –
128
[V83:32] Hansbauer, P.:
„Straßenkinder“
. Anmerkungen
zu einem
„neuen“
Phänomen. In: Jahrbuch der Sozialen
Arbeit 1997. Münster 1996
[V83:33] Hauser, R./Hübinger, W.: Arme unter uns. 2 Teile, hrsg. vom Deutschen
Caritasverband e.V., Freiburg 1993
[V83:34] Hetzer,
H.: Kindheit und Armut. 2. Aufl. Leipzig 1937
[V83:35] Jahrbuch
Sucht 1992, hrsg. von der Deutschen Hauptstelle gegen die
Suchtgefahren, Geesthacht 1991
[V83:36] Jordan,
E./Sengling, D.: Einführung in die
Jugendhilfe, München 1977
[V83:37] Krafeld,
F. J.: Geschichte der Jugendarbeit. Von den Anfängen bis zur Gegenwart,
Weinheim/Basel 1984
[V83:38] Kreft,
D./Mielenz, J. (Hrsg.): Wörterbuch Soziale
Arbeit, Weinheim/Basel 1988
[V83:39] Krüger,
H.-H./Helsper, W. (Hrsg.): Einführung in
Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Opladen
1995
[V83:40] Krüger,
H.-H./Marotzki, W. (Hrsg.):
Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. Opladen
1995
[V83:41] Krüger,
H.-H./Rauschenbach, Th. (Hrsg.): Einführung
in die Arbeitsfelder der Erziehungswissenschaft. Opladen
1995
[V83:42] Landes-Kinderbericht. Bericht der Landesregierung über die
Situation des Kindes in Nordrhein-Westfalen, Köln 1980
[V83:43] Landwehr, R./Baron, R. (Hrsg.): Geschichte
der Sozialarbeit. Hauptlinien ihrer Entwicklung im 19. und 20.
Jahrhundert, Weinheim/Basel 1983
[V83:44] Leibfried, St./Pierson, P. (Hrsg.):
European Social Policy. Between Fragmentation and Integration.
Washington D. C. 1995
[V83:45] Lenzen,
D. (Hrsg.): Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek
1994
[V83:46] Lenzen,
D.: Handlung und Reflexion. Vom pädagogischen Theoriedefizit zur
Reflexiven Erziehungswissenschaft. Weinheim und Basel 1996
[V83:47] Lüders,
Chr./Winkler, M.: Sozialpädagogik – auf dem
Weg zu ihrer Normalität. In: ZfPäd. 1992, Heft 3, S. 359 –
370
[V83:48] Mannheim, K.: Das Problem der Generationen. In: Kölner
Vierteljahrshefte für Soziologie, Jg. 1928, Heft 2, S. 157 – 185;
Heft 3, S. 309 – 330
[V83:49] Meyer-Drawe, K.: Menschen im Spiegel ihrer Maschinen. München
1996
[V83:50] Mollenhauer, K./Uhlendorff, U.: Sozialpädagogische Diagnosen II.
Selbstdeutungen verhaltensschwieriger Jugendlicher als empirische
Grundlage für Erziehungspläne. Weinheim/München
1995
[V83:51] Mollenhauer, K.:
Einführung in die Sozialpädagogik, Weinheim
[V83:52] Mollenhauer, K.: Sozialpädagogische
Einrichtungen. In: Lenzen, D. (Hrsg.),
a. a. O., S. 447 – 476
[V83:53] Mollenhauer, K. u. a.: Grundfragen
ästhetischer Bildung. Weinheim/München 1996
[V83:54] Müller,
C. W. (Hrsg.): Einführung in die Soziale Arbeit, Weinheim/Basel
1985
[V83:55] Müller,
H.-R.: Ästhesiologie der Bildung. Bildungstheoretische Rückblicke auf
die Anthropologie der Sinne im 18. Jahrhundert. Manuskript 1996. Im
Druck
[V83:56] Niemeyer, Chr.: Entstehung und Krise der Weimarer Sozialpädagogik.
In: ZfPäd. 1993, Heft 4, S. 437 – 453
[V83:57] Nohl,
H./Pallat, L. (Hrsg.): Sozialpädagogik.
Sonderdruck aus dem Handbuch der Pädagogik, Langensalza
1929
[V83:58] Nölke,
E.: Lebensgeschichte und Marginalisierung. Hermeneutische
Fallrekonstruktionen gescheiterter Sozialisationsverläufe von
Jugendlichen. Wiesbaden 1994
[V83:59] Otto, H.-U./Schneider, S.
(Hrsg.): Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit, Neuwied/Berlin
1973
[V83:60] Otto,
H.-U./Sünker, H. (Hrsg.): Soziale Arbeit und
Faschismus, Frankfurt/M. 1989
[V83:61] Parmentier, M.: Ethnomethodologie. In: D. Lenzen/K. Mollenhauer (Hrsg.):
Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 1, Stuttgart/Dresden 1995, S.
246 – 261
[V83:62] Prange,
K.: Alte Schwierigkeiten – neue Konfusionen. Bemerkungen zu dem
Hamburger-Memorandum der universitären Sozialpädagogik. In:
Erziehungswissenschaft 1996, Heft 14, S. 63 – 75
[V83:63] Rauschenbach, Th./Gängler, H. (Hrsg.):
Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft, Neuwied
1992
[V83:64] Rauschenbach, Th./Ortmann, Fr./Karsten, M.-E. (Hrsg.): Der sozialpädagogische
Blick. Lebensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit.
Weinheim/München 1993
[V83:65] Rauschenbach, Th.: Der neue Generationenvertrag. Von der
privaten Erziehung zu den sozialen Diensten. In: Bildung und Erziehung
in Europa. Beiträge zum 14. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft, hrsg. von D. Benner und
D. Lenzen. Weinheim/Basel 1994
[V83:66] Röper,
F.: Das verwaiste Kind in Anstalt und Heim. Ein Beitrag zur historischen
Entwicklung der Fremderziehung, Göttingen 1976
[V83:67] Rorty,
R.: Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt/M. 1989
[V83:68] Rumpf,
H.: Die künstliche Schule und das wirkliche Lernen. Weinheim und München 1986
[V83:69] Rutschky, K.: Deutsche Kinderchronik. Wunsch- und Schreckensbilder
aus vier Jahrhunderten, Köln 1983
[V83:70] Sachße, Chr./Tennstedt, F.: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, 3
Bände, Stuttgart/Berlin/Köln 1980,1988 und 1992
[V83:71] Sachße,
Chr.: Berufsgeschichte und Berufsidentität. In: Rauschenbach u. a., a. a. O.
[V83:72] Schleiermacher, F.: Pädagogische Schriften 1. Unter Mitwirkung
von Th. Schulze herausgegeben von E. Weniger. Frankfurt/M., Berlin, Wien 1984
[V83:73] Schütze,
F.: Die Fallanalyse. Zur wissenschaftlichen Fundierung einer klassischen
Methode der Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach
u. a., a. a. O:
[V83:74] Schwab, M.: Thesen zum Begriff der
„Lebenswelt“
-Orientierung. In: Forum Erziehungshilfen, 1996, Heft
3, S. 132 – 137
[V83:75] Schwab,
U.: Evangelische Jugendarbeit in Bayern 1800–1933, München
1992
[V83:76] Simonsohn, B. (Hrsg.): Fürsorgeerziehung und
Jugendstrafvollzug, Bad Heilbrunn 1969
[V83:77] Statistisches
Bundesamt: Einrichtungen und tätige Personen in der
Jugendhilfe, Fachserie 13, Reihe 6.3, Stuttgart 1986
[V83:78] Statistisches
Bundesamt: Maßnahmen der Jugendarbeit im Rahmen der
Jugendhilfe, Fachserie 13, Reihe 6.2, Stuttgart 1988
[V83:79] Sünkel,
W.: Generation als pädagogischer Begriff. In: Liebau, E./Wulf, Chr.: Generation. Weinheim 1996
[V83:80] Tenbruck, F. H.: Jugend und Gesellschaft. Freiburg
1962
[V83:81] Thiersch, H.: Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer
alltagsorientierten Sozialpädagogik, Weinheim/München 1986
[V83:82] Thiersch, H.: Strukturelle Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten
Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach u. a.,
a. a. O.
[V83:83] Winkler,
M.: Eine Theorie der Sozialpädagogik. Stuttgart 1988
[V83:84] Zander,
H.: Armut. In: Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik, hrsg. von H.
Eyferth, H.-U. Otto
und H. Thiersch. Neuwied/Darmstadt 1984, S. 132 –
148
[V83:85] Zwerger,
B.: Bewahranstalt – Kleinkinderschule – Kindergarten. Aspekte nicht
familialer Kleinkindererziehung in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert, Weinheim/Basel 1980